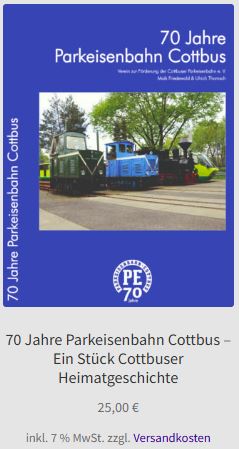Wer Kohle in der Stadtkasse braucht, kann nicht gegen Kohle aus dem Bergbau sein. Das ist zwischen den Zeilen aus der Stellungnahme der Stadt Spremberg zu lesen, in der sich die Stadtverordneten für den Braunkohlebergbau aussprechen. Dass die Stadt ohne diese Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr in die Daseinsfürsorge investieren kann, ist ein Offenbarungseid, aber diesen so offen auszusprechen, ist ehrlich. Gleiches Problem – andere Stadt: Auch im Cottbuser Haushalt klafft ein Loch durch fehlende Gewerbesteuereinnahmen. Ob die Stadt noch Kredite für Investitionen bekommt, ist fraglich. Daher ist es für die Politiker der Region keine Frage, ob man für oder gegen den Braunkohletagebau mit seinen Folgen für Landschaft und Leute ist. Die braune und die papierne Kohle wird gebraucht. Arbeitsplätze ebenso. Was aber auch gebraucht wird, sind offene Ohren. Diese müssen die Stimmen von Proschim und Grabko bis Kerkwitz und Atterwasch hören. Das Finden einer „einvernehmlichen Lösung“, nennt das der Spremberger Bürgermeister. Doch diese Lösungssuche scheint der nach einem Perpetuum mobile zu ähneln: gewollt und doch unauffindbar. Leere Kassen stehen auf der einen und die Furcht vor Enteignungen sowie dem Heimatverlust auf der anderen Seite. Und wo bleibt das grüne Gewissen? Im Nachbarland Polen, das Atomkraftwerke bauen will, heißt es, dass die Menschen andere Sorgen haben. Ein grünes Gewissen müsse man sich leisten können.
Wer Kohle in der Stadtkasse braucht, kann nicht gegen Kohle aus dem Bergbau sein. Das ist zwischen den Zeilen aus der Stellungnahme der Stadt Spremberg zu lesen, in der sich die Stadtverordneten für den Braunkohlebergbau aussprechen. Dass die Stadt ohne diese Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr in die Daseinsfürsorge investieren kann, ist ein Offenbarungseid, aber diesen so offen auszusprechen, ist ehrlich. Gleiches Problem – andere Stadt: Auch im Cottbuser Haushalt klafft ein Loch durch fehlende Gewerbesteuereinnahmen. Ob die Stadt noch Kredite für Investitionen bekommt, ist fraglich. Daher ist es für die Politiker der Region keine Frage, ob man für oder gegen den Braunkohletagebau mit seinen Folgen für Landschaft und Leute ist. Die braune und die papierne Kohle wird gebraucht. Arbeitsplätze ebenso. Was aber auch gebraucht wird, sind offene Ohren. Diese müssen die Stimmen von Proschim und Grabko bis Kerkwitz und Atterwasch hören. Das Finden einer „einvernehmlichen Lösung“, nennt das der Spremberger Bürgermeister. Doch diese Lösungssuche scheint der nach einem Perpetuum mobile zu ähneln: gewollt und doch unauffindbar. Leere Kassen stehen auf der einen und die Furcht vor Enteignungen sowie dem Heimatverlust auf der anderen Seite. Und wo bleibt das grüne Gewissen? Im Nachbarland Polen, das Atomkraftwerke bauen will, heißt es, dass die Menschen andere Sorgen haben. Ein grünes Gewissen müsse man sich leisten können.
Offensichtlich kann auch die Lausitz keine Rücksicht auf grüne Argumente nehmen. Die Hand abzuschlagen, die einen nährt, will in den Rathäusern jedenfalls niemand. Mathias Klinkmüller
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen